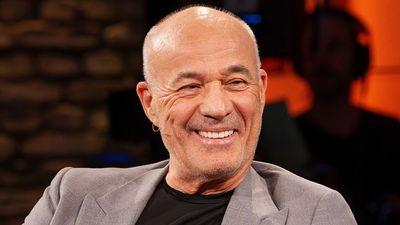02.11.2025 von SWYRL/Wilfried Geldner
In der Dokufiction von Dirk Eisfeldt begegnen sich am Rande des Nürnberger Prozesses von 1945 zwei ehemalige KZ-Gefangene. Sie überlebten den Holocaust nur knapp und wollen nun als Zeugin und Reporter über die unvorstellbaren Gräuel berichten.
Sie sind zwei unter tausend, die sich bei einem der wichtigsten Prozesse des 20. Jahrhunderts begegnen, beim ersten der Nürnberger Prozesse, der am 20. November 1945 begann und die noch lebenden Verantwortlichen des Naziregimes zur Rechenschaft zog. Erstmals sollten sich Einzelne nicht auf das Staatsrecht zurückziehen können. Der Reporter Ernst Michel aus Mannheim und die polnische Widerstandskämpferin Seweryna Szmaglewska hatten das KZ vor nur wenigen Monaten überlebt. Jetzt konnten sie den Tätern im Gerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalasts in die Augen sehen. - Die ARD-History-Doku "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" von Carsten Gutschmidt arbeitet mit vielen Spielszenen, aber auch mit neuen und wiederentdeckten Interviewaufnahmen auf mehreren Ebenen. Restaurierte und digitalisierte Archivaufnahmen aus Auschwitz und aus dem Nürnberger Gerichtssaal kommen hinzu.
Alles beginnt mit einem Albtraum des damals 22-jährigen Reporters Ernst Michel. Er begegnet darin dem "Angeklagten Nummer eins", dem von Hitler zu seinem Nachfolger bestellten Hermann Göring. Man habe ihn wohl übersehen beim Töten, sagt er zu Ernst, das müsse nun nachgeholt werden. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer löst sich die Szene als Albtraum auf, die Traumata der ehemaligen KZ-Häftlinge jedoch bleiben. Davon berichten im Film in einem Archiv-Interview (2005) der nun gealterte jüdische Reporter, der die Eltern in Auschwitz verlor, aber auch seine Tochter Lauren Shachar, die authentisch von den Erlebnissen und Gefühlen des Vaters erzählt. Ernst Michel wurde durch seine objektiven Agenturberichte, die im Film leider nur in Schlagzeilen wiedergegeben werden, weltweit bekannt.
Aber auch im Nürnberger Gefängnis will der angeklagte Naziführer Hermann Göring den jungen Reporter treffen, der als einziger Pressevertreter zugleich KZ-Insasse war und seine KZ-Nummer unter seine Artikel schreibt. Die Frage nach dem "Warum?" ist es, die ihn antreibt. Sie bleibt unbeantwortet bis zuletzt, es ist nicht nur eine Schwäche der stets zwischen penibler Historie und hinzugefügter Fiktion pendelnden Dokumentation.
Seweryna Szmaglewska (im Film authentisch gespielt von Katharina Stark) wurde nach dem Krieg in Polen vor allem wegen ihrer persönlichen Auschwitz-Berichte bekannt und vielfach in Schulen gelesen. Ihr Roman "Rauch über Birkenau" erschien in Polen bereits 1945 (in Deutschland erst 75 Jahre danach, unter dem Titel "Die Frauen von Birkenau"). Im Film muss sie lange auf ihren Zeugenaufruf warten. Ihre Aussagen werden schließlich auf ihre Beobachtungen beim mörderischen Umgang mit Babys und Kindern reduziert. Doch Ernst verspricht ihr, ihren Auftritt durch seinen Bericht weltweit zu verbreiten.
Abonniere doch jetzt unseren Newsletter.
Wenn Menschen zu viel Macht bekommen
Dass sich in Rückblenden Seweryna in einen anderen KZ-Häftling verliebt und ihm die Ehe verspricht, dass sich die beiden aus den Augen verlieren und glauben, für immer für einander verloren zu sein, hätte samt Happyend und Wiedersehen (dank des Agenturartikels über ihren Auftritt im Zeugenstand) schon für einen großen Spielfilm gereicht. Im ARD-Film - halb Doku, halb Fiktion - werden ihre Schicksale jedoch mit vielfachen Reflexionen und Erinnerungen verschnitten. Vor allem für Ernst, den Jonathan Berlin großartig zurückhaltend mit starrem, tieftraurigen Blick verkörpert, ist die Frage: "Wie konnte das Unbegreifliche geschehen?"
Das große "Warum?" steht über allem. Michels Tochter Lauren Shachar immerhin gibt am Ende eine Auslegung, bevor sie den heute umgestalteten Nürnberger Gerichtssaal 600 verlässt: "Das Unheil entsteht, wenn Menschen zu viel Macht bekommen", so sagt sie - eine Auslegung, die zweifellos von aktueller Gültigkeit ist.
Den "Tag der Gerechtigkeit" zu erleben, als "Stellvertreter für Millionen Opfer" wurde für Ernst Michel Trost und Genugtuung zugleich. Zum Hassprediger wollte er nicht taugen. Er hat sie im Justizpalast gesehen, die Führer der Nazis, die zu Beginn des Prozesses lässig auf den Sitzen lümmelten und angesichts der vorgeführten Opferaufnahmen aus den KZs scheinbar ungläubig lachten. Am Ende waren sie für ihn "unerheblich und klein".